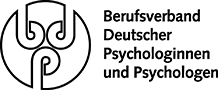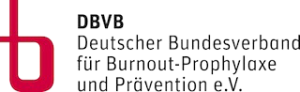Aktuell können Sie mit mir einen Videotermin vereinbaren
Mit dem Begriff der Resilienz wird die seelische Widerstandsfähigkeit oder auch Unverwüstlichkeit bezeichnet. Konflikte, Misserfolge, Niederlagen große Lebenskrisen oder traumatische Erfahrungen können mit einer inneren Stärke des Menschen gut gemeistert werden. Man spricht hier von Menschen mit einer starken Resilienz.
So unterschiedlich die Menschen auch sind, so unterschiedlich ist auch die Ausprägung der eines Menschen eigenen Resilienz. So gibt es Menschen, die Belastungen eher als Herausforderungen sehen, andere hingegen fühlen sich in Belastungssituationen schnell hilflos.
In der Kindheit werden Grundlagen für die Resilienz gelegt
Bereits in der Kindheit wird unsere Resilienz z.B. durch das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit durch eine feste Bezugsperson in dieser Zeit gefördert. Wichtig ist immer eine positive Bestärkung und Unterstützung durch die Eltern sowie die Erfahrung von Akzeptanz und Achtung.
Eltern mit einer eigenen starken Resilienz, können als Vorbild fungieren, wie man mit Krisen umgeht. Im Modell-Lernen können die Kinder Verhaltensweisen kopieren. Außerdem kann das Erlebnis positiver zwischenmenschlicher Erfahrungen in der Familie, mit Freunden und Mitmenschen sich positiv begünstigend sich auf eine starke Resilienz auswirken.
Resilienz kann auch im Erwachsenenleben trainiert und entwickelt werden
Resilienz ist keinesfalls ein statisches Thema und kann auch im Erwachsenenleben trainiert und entwickelt werden.
Für eine gute seelische Widerstandskraft sind z. B. ein aktives Verantwortungsgefühl und ein Gefühl der Möglichkeit einer Einflussnahme auf das eigene Leben von Bedeutung. Selbstvertrauen und eine innere Stärke können helfen in emotional turbulenten Situationen eine Lösung zu finden.
Ein soziales Netzwerk vermittelt das Gefühl, nicht alleine zu sein und kann somit die Resilienz stärken. Ferner ist es auch wichtig, andere um Hilfe bitten zu können. Und abschließend sind bereits positiv gemachte Erfahrungen in der Krisenbewältigung und eine optimistische Grundhaltung sehr hilfreich.
Wie auch im letzten Jahr konnte ich bei den 5. Eppendorfer Depressionstagen im UKE viele neue Erkenntnisse mitnehmen.
Depression und Burnout wurden im berufliche Kontext beleuchtet, es wurde ein aktueller Stand gezeigt auch im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen. Aktuell leiden rund 4 Millionen Bundesbürger unter einer behandlungsbedürftigen Depression. Fehlzeiten aufgrund psychischer Belastungen in der Arbeitswelt haben von 1998 bis 2009 um 76% zugenommen. 38% der Frühverrentungen wurden aufgrund von seelischen Krankheiten bewilligt.
Was ist eigentlich genau was? Erschöpfung-Burnout-Depression?
Es wurden klinische Aspekte chronischer Erschöpfungssyndrome im Kontext mit psychischen Belastungen in der Arbeitswelt gestellt.
Burnout wird in drei Dimensionen aufgeteilt:
1. Emotionale Erschöpfung
Es herrscht ein Gefühl der Überforderung und des Ausgelaugtseins bezüglich psychischer und kölrperlicher Reserven. Mit dem Energiemangel verbunden treten Müdigkeit, Niedergeschlagenheit und Anspannungszustände auf. Der Betroffene leidet unter Schlafstörungen und ist unfähig, sich in der Freizeit zu entspannen. Zu den häufigsten körperlichen Beschwerden gehören Magen-Darm Symptome, Kopf- und Rückenschmerzen und häufig auftretende Infekte.
2. Zynismus/Distanzierung/Depersonalisation
Aus dem idealisierten Verhältnis zur Arbeit, die meist mit positiven Erwartungen begonnen wurde, entwickelt sich zunehmend Frustration und schließlich distanziert sich der Betroffene von seiner Arbeit. Der Betroffene macht Schuldzuweisungen für die verändert erlebte Arbeit und ist über die Arbeitsbedingungen verbittert. Er wertet die Arbeit ab und reagiert zynisch gegenüber Arbeitskollegen. Daraus ergeben sich Schuldgefühle. Häufig ergibt sich ein Gefühlsverlust (Depersonalisation).
3. Verringerte Arbeitsleistung
In der Selbsteinschätzung erlebt der Betroffene eine nachhaltige Minderung der Arbeitsleistung unteranderem durch Arbeitsunzufriedenheit und Konzentrationsstörungen.
Eine zentrale Frage ist bis heute aus der Forschung noch nicht beantwortet: Warum hat ein Mensch eine Depression?
Am Ende der Veranstaltung wurde der Frage kritisch nachgegangen, ob unser Gesundheitssystem den steigenden Versorgungsansprüchen durch psychische Erkrankungen am Beispiel der Depression gewachsen ist.
Gerade bei Berufsanfängern und auch bei Personen, die mit neuen Aufgaben in ihrem Beruf konfrontiert werden, ist es sehr wichtig, wie sie ihre eigene Kompetenz einschätzen und somit erwarten. Die Selbstwirksamkeit bezieht sich auf die Frage, ob sich eine Person die Ausführung eines bestimmten Verhaltens zutraut oder nicht. Sie wird unterschieden von der Erfolgserwartung, mit der eingeschätzt wird, wie wahrscheinlich das richtig ausgeführte Verhalten zum Erfolg führt. Die Selbstwirksamkeit setzt sich aus der Kompetenzerwartung und Wirksamkeitserwartung zusammen.
Verhaltenskontrolle durch Kompetenzerwartungen
Hier gibt es drei Möglichkeiten: realistische Einschätzung der eigenen Kompetenzen sowie Über- oder Unterschätzung. Realistische Selbsteinschätzung führt zur optimalen Ausnützung der eigenen Fähigkeiten, Überschätzung zu aversiven Konsequenzen (wer glaubt, den Mount Everest nackt besteigen zu können, der wird erfrieren) und Unterschätzung zu unangemessener Selbstbeschränkung (Überängstlichkeit, Angebote ablehnen, weil man glaubt, dem nicht gewachsen zu sein )
Eine Person, die sich als kompetent einschätzt,
meistert schwierige und angsterregende Situationen besser, setzt sich mehr für die entsprechende Aufgabe ein und ist um so mehr motiviert, wenn sie mit vergangener Leistung zufrieden ist.
Eine Person, die sich als inkompetent einschätzt,
richtet ihre Aufmerksamkeit in schwierigen und angsterrengenden Situationen auf sich und überschätzt die Schwierigkeit der Situation. Weil sie dadurch erregter wird, verschlechtert sich ihre Leistung, versucht, die entsprechende Aufgabe zu vermeiden und gibt bei Hindernissen und Schwierigkeiten schneller auf.
Effekte der Selbstwirksamkeit
Selbstwirksamkeit steht einerseits in Zusammenhang mit vergangener Erfahrung, beeinflußt andererseits auch zukünftige Erfahrungen. Dies hängt wesentlich vom Niveau, der Stärke und vor allem der Universalität der individuellen Wirksamkeitserwartungen ab.
Personen mit hochgeneralisierten Wirksamkeitserfahrungen sind in den unterschiedlichsten Lebenssituationen erfolgreicher, als solche, die nur über begrenzte Erfahrungen der Selbstwirksamkeit verfügen. Selbstwirksamkeit beeinflußt die Vorbereitung einer Handlung und das Ausmaß der Anstrengung bei schwierigen Aufgaben. Außerdem bestimme es die Ausdauer bei der Bewältigung einer aversiven Situation sowie die sie begleitenden Gefühle und Gedanken (z.B. Angst vs. Geschwindigkeitsrausch beim Skifahren).
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen beeinflussen die Selbstregulation des Verhaltens, z.B. die Auswahl und Gestaltung von Situationen. Außerdem unterstützen sie die von anderen unabhängige Selbstbekräftigung. Sie sind eine wichtige Voraussetzung für innovatives Handeln und den Prozeß der Selbstentwicklung.
Es gibt immer mehr Menschen, die sich in ihrer sogenannten „Lebensmitte“ nach einem neuen Beruf sehnen. Oft ist dies mit einem Wechsel von einem Angestelltenverhältnis in die Selbständigkeit verbunden. Es gibt aber auch immer mehr Menschen, die bereits mit 30 Jahren über einen Wechsel nachdenken. Vor allem Frauen kommen mit diesem Wunsch zu meinem Coaching in dieser Altersgruppe immer mehr. Dies liegt eventuell daran, dass sie sich im Alter um die 30 mit der Kinderfrage verstärkt beschäftigen. Es könnte zum einen nach einem passenderen Beruf gesucht werden, der mit Kinder kompatibler ist als der jetzige. Es könnte aber auch zum anderen deshalb nach einem anderen Beruf gesucht werden, da sie sich darüber bewusst werden, dass ein Kind nicht geplant ist und der jetzige Beruf nicht die erhoffte Erfüllung bringt.
Wie geht man dann bei einem Wunsch nach beruflicher Veränderung eigentlich genau vor?
Ich versuche auch nach unbewussten Gründen bei den Klienten zu forschen. Das können unbewusste Ängste sein, die sich in der jetzigen Tätigkeit verfestigt haben und negative Gefühle auslösen. Das können verherrlichte Berufsvorstellungen aus der Jugend sein, die in der heutigen Zeit gar nicht zu realisieren wären. Auch das Elternhaus spielt eine wichtige Rolle. Sind hier noch unausgesprochene Wunschvorstellungen der Eltern offen und man möchte es Ihnen jetzt Recht machen?
Dann begebe ich mit den Klienten in den Analysebereich. Folgende Fragen werden bearbeitet: Wie schätzt sich der Klient selber und sein Potential ein? Wie wird der Klient durch Familie und Freunde fremd eingeschätzt? Ich führe dann noch Tests mit dem Klienten durch. Im Abschluß dieser Phase fasse ich alles zusammen. Dies bildet nun die Grundlage für die weitere Coaching-Termine.
Ein wichtiger weiterer Part ist die Bedürfnissanalyse und die Selbstreflexion über Talente, Stärken und Interessen des Klienten.
Die weitere Vorgehensweise ist sehr individuell und ich ziehe natürlich auch immer die wirtschaftliche Machbarkeit in Betracht. Oft entstehen nach einem Coaching für die Berufsneuorientierung andere Sichtweisen zu der jetzigen Tätigkeit. Nachdem sich einige Klienten damit befasst haben, einen Wechsel zu vollziehen, beginnen sie die Vorteile ihrer jetzigen Tätigkeit zu schätzen und erarbeiten sich nun kleinere Veränderungen innerhalb ihres Berufs. Andere sind nach dem Coaching gestärkt und planen nun den Wechsel gründlich und überstürzen allerdings nichts.
Bei der Frage nach einer gemachten Entscheidung hört man von Kollegen oder Vorgesetzten oft die Antwort :“ … ach das habe ich ganz intuitiv entschieden…!“ Aber was ist das eigentlich genau? Woher kommt das? Kann das jeder lernen?
Das Entscheidene bei der Intuition ist auf der einen Seite, dass sie blitzschnell abrufbar ist und auf der anderen Seite durch die bereits gemachten Erfahrungen aus der Vergangenheit geprägt ist.
Gerade in Ausnahmezuständen oder Notfällen reagieren Menschen intuitiv richtig. Wenn allerdings im Berufsleben Entscheidungen nicht zwingend schnell getroffen werden müssen, verlassen sich viele eben nicht mehr auf ihre Intuition, sondern es werden Überlegungen über einen längeren Zeitraum gemacht, es werden Pro und Kontra abgewägt und ein intuitives Handeln wird gerade im Beruf schnell verlernt. Somit kann man keine positiven Erfolge mit seiner eigenen Intuition erzielen und erinnert sich daran bei neuen Entscheidungen nicht zurück. Es ist dann vielmehr sogar so, dass man die Impulse aus dem Unterbewusstsein bei zukünftigen Entscheidungen unterdrückt.
Besonders in der Managementebene gehört intuitives Handeln dazu
Nur wer Mut hat, auf seine Intuition zu hören, danach zu handeln, kann Erfahrungen sammeln – gute wie schlechte. Wer viele Erfahrungen sammelt, diese kritisch reflektiert und bei Entscheidungen richtig abruft und anwendet, ist im Unternehmen oft erfolgreicher. Folglich finden sich eben auch mehr intuitiv handelnde Manager auf den Top-Positionen in Unternehmen. Das Hören auf das Bauchgefühl mit entsprechendem Handeln gehört zur Schlüsselqualifikation guter Manager.
Wer sind die Feinde des intuitiven Handelns?
Der Verstand kommt sofort bei einer aus dem Bauch heraus getroffenen Entscheidung und schlägt Alarm. Zum Beispiel bei einer Personalentscheidung, wo die Fakten alle für eine Bewerberin sprechen, aber der Bauch des Unternehmers sich für die andere Kandidatin entscheidet. Diese Entscheidungen sind für Außenstehende oft nicht nachvollziehbar
Die Angst folgt auch, da die Entscheidung vom Verstand nicht mit eindeutigen Pro-Gründen abgesegnet ist. Zum Beispiel bei einem beruflichen Neuanfang mit 50 Jahren ist es oft so, dass natürlich die Argumente, die für Sicherheit und Beständigkeit und Berufserfahrung stehen dem Neuanfang widersprechen. Folglich entscheidet der Manager auch eher aus dem Bauch heraus, wenn er sich nach stressreichen Berufsjahren in der Wirtschaft für einen Neuanfang mit einer Skihütte in den Bergen entscheidet.
Kann ich wieder lernen, intuitiv zu handeln?
In stressreichen Zeiten können wir uns oft nicht mit uns selber beschäftigen. Wir haben keine Zeit, zu reflektieren. Deshalb ist es erstmal gut, sich Freiräume zu schaffen. Geschehenes kann man Revue passieren lassen, gefällte Entscheidungen überdenken und überlegen, wie sich Situationen geändert hätten, wenn man sich anders entschieden hätte. Ein Vertrauen zu sich selber finden. Nicht zu sehr von anderen bei der Meinungsbildung beeinflussen lassen. Die Intuition kommt aus einem selber heraus und wird uns nicht von anderen vor diktiert.